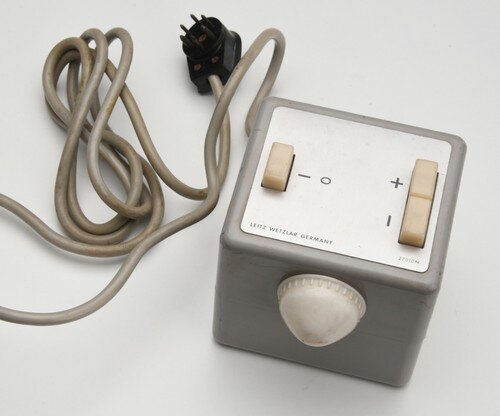-
Gesamte Inhalte
8.304 -
Benutzer seit
-
Letzter Besuch
-
Tagessiege
216
Inhaltstyp
Profile
Forum
Galerie
Alle erstellten Inhalte von Film-Mechaniker
-
Old School? http://cgi.ebay.com/...=item415753a93a http://introtoediting.com/sound.html
-
Hoffe, es ist nicht so arg ein Problem. Stephen ist international tätiger Kameramann und kennt die Szene im Vereinigten Königreich.
-
Frag Stephen Williams, sw@stephenw.com, ein Engländer, Kameraprofi, der in der Schweiz lebt. Gruß von einem Vollzürcher
-
Die Frezzolini waren Ableitungen der CP, welche ihrerseits von den Berndt-Bach abstammen. Während bei Motor, Gehäuse und Magazin einiges anders konstruiert wurde, blieb der Filmantrieb der gleiche. Es gibt da eine gefederte Stahlkugel, auf der der Film mit einem Perforationsloch einrastet, eine umwerfende Idee. Was du brauchst, ist ein Spezialist, der sich der Kamera annimmt. Es kann nicht so schlimm sein, denn immerhin will jemand Geld für sie. Meine Bedenken richten sich eher auf Optik und Objektivhalterung. Wenn da ein Schlag drin ist, kann es aufwändig werden, alles wieder ins Lot zu bringen. Das Angénieux-Zoom ist obsolet, also schau’, daß du mit der vorhandenen Halterung andere Objektive ansetzen kannst oder daß du zu einer anderen Halterung kommst. Die Kamera ist laufleise, ich kenne die CP, mit der wir Direkttonaufnahmen machten. Du hast 400-Fuß-Magazin und Quarzsteuerung. Ich glaube, du hast Glück gehabt. Aber investiere das gesparte Geld in gründliche Revision.
-

wie sahen die ersten kinos von innen aus?
Film-Mechaniker antwortete auf UlliTD's Thema in Allgemeines Board
Ja, das Klavier fehlt. Tonfilm? Die erste lippensynchrone Tonfilmvorstellung fand 1921 statt, zehn Jahre nach dieser Aufnahme. -

wie sahen die ersten kinos von innen aus?
Film-Mechaniker antwortete auf UlliTD's Thema in Allgemeines Board
Fata Morgana, Basel, vor dem Ersten Weltkrieg -
Nasskleben ist sozusagen das Rechte, Trockenkleben demnach das Linke. Nein, ohne Kohl, gut gemachte nasse Spleiße halten so lange, wie der Film besteht. Bei den Klebebändern gibt es unterschiedliche Qualitäten bei unterschiedlichen Preisen. Die guten Klebstoffe bauen eine sehr gute Verbindung auf und trocknen über die Jahre langsam aus. Schlechtere halten auch gut, schmieren aber nach und nach. Nasse Klebestellen kosten sehr wenig Geld, verlangen dafür deinen Einsatz. Es dauert etwas länger als mit Klebeband, macht dafür Freude, wenn man’s kann. Es war kein Einwand, bloß eine Feststellung. Zehntausende von Filmamateuren schneiden ihre Originale, Hunderttausende. Wenn du Kopien willst, wende dich an Andec, Berlin. Zur Filmreinigung nimmst du Isopropanol, das ist ein Alkohol, oder Reinbenzin. Beide Stoffe sind gute Entfetter. Perchlorethylen ist noch gründlicher, aber umweltschädlich und ungesund. Tetrachlorkohlenstoff wurde früher verwendet, es ist krebserregend. Jetzt bist du im Bilde. Ich finde die Agfa-Klebepressen gut, die gab’s für Normal-8- und Super-8-Film. Andere Produkte sind auch gut, es ist auch ein Stück weit Geschmackssache. Was hast du denn so vor?
-
Hallo, Damien Soso, du willst am Schneidetisch schneiden. Lasse mich dir einige Begriffe darlegen, damit sich ein Mal das Gröbste klärt. Schneidetisch kann ein einfacher Holztisch sein, auf dem du Filme zerteilst, so gesehen alles paletti, doch die meisten Filmer verstehen unter einem Schneidetisch ein spezielles Arbeitsgerät des Cutters, das zwischen 15'000 und 50'000 Euro kostet. Es gibt noch einige wenige Hersteller von Schneidetischen, z. B. KEM in Hamburg, wo man sich natürlich freut, dir einen schönen neuen zu liefern. Schneidetische gibt es für alle Filmformate, neue für Super-8-Film liefert Steenbeck in den Niederlanden. Was ich dir raten mag, ist Folgendes: Umrollerpaar, vielleicht zusammen mit einem Filmbetrachter, das ist die tragbare Variante des Schneidetisches. Dann Klebepresse und Filmkitt für nasse Montage oder Klebelade und Selbstklebeware für trockene Montage. Einige Leerspulen, ein Regal zum Ablegen der Abschnitte, Schere, Filzschreiber zum Markieren, Samtlappen und Chemikalien zur Filmreinigung, eventuell Baumwollhandschuhe. Schreibblock und Bleistift Praktisch sind die Überwurfdeckeln der 50-Fuß-Spulen, auf denen du die entwickelten Filme zurückerhältst. In sie kann man Abschnitte legen, außen kann man sie beschriften. Jedem sein eigenes System! Um kurz zum Schneidetisch zurückzukommen, ein solches Gerät dient hauptsächlich zwei Zwecken. Erstens lassen sich Bild und Ton darauf zueinander synchronisieren, der Ton wurde dazu im Tonstudio auf Magnetfilm umgespielt, das ist etwas stärkeres Magnettonband in gleicher Breite und mit gleicher Perforation, wie der Bildfilm hat. Genau hier kommt die Synchronklappe zum Zug. Zweitens können mit einem ausgewachsenen Schneidetisch alle Bild- und Tonelemente eines Films miteinander ausprobiert werden, bis alles Schnittmaterial die fertige Vorlage für die Montage der Originale darstellt. Auf den Schneidetisch kommen also stets nur Kopien, nie Originale. An einem 100-Minuten-Film arbeiten mehrere Leute während Wochen, die Muster sind hinterher voll von Markierungen, aufgehobenen Schnitten, Fingerabdrücken und Dreck. Du wirst vermutlich deine Filmoriginale zerschneiden. Warum nicht. Es ist dein Plan, der entscheidet. Viel Glück!
-

"Analogisieren" also zurück von DVD auf Super-8
Film-Mechaniker antwortete auf Guest_Rudolf 51's Thema in Schmalfilm
Will nicht arrogant erscheinen: Man braucht meine Beiträge nur aufmerksam zu lesen, es ist alles da. Ich vergrößere zum Schreiben mit Steuertaste und +, habe das Textverarbeitungsprogramm neben dem Forum offen, hole mir von dort die Zeichen, die ich haben will (¾↨ЯºJ♫╘) und überlege manchmal lange, wie ich mich ausdrücken soll. Korrektur an meinem letzten Beitrag: Schostka und die Filmfabrik Svema sind nicht russisch, sondern befinden sich in der Ukraine, und zwar an der Gagarin-Straße 1. Kurz vor der Wende hatte das Kombinat 12'000 Angestellte. -

"Analogisieren" also zurück von DVD auf Super-8
Film-Mechaniker antwortete auf Guest_Rudolf 51's Thema in Schmalfilm
Da ich die Schwarzweißfilme des Weltmarktes überblicke, kann es sich nur um ein Produkt aus Schostka handeln. Farbloser, etwas dünnerer Polyesterträger, P-Perforation, kein Lichthofschutz, so etwas wie ein Ersatz für ein Dupliziernegativmaterial. Möglicherweise ein nach Ilford-Rezeptur hergestellter Allround-Film für Kinematografie und Fotografie Im Westen haben Kineduplizierfilme N-Perforation. Man kann die Orwo-Filme mit P-Perforation haben, aber die haben andere Empfindlichkeit. Jemand sitzt vermutlich auf einem Lager voll davon und packt es nach und nach in Dosen. Polypan F ist ja etwa zu der Zeit aufgetaucht, als bei Svema die Räder zum Stillstand kamen, 2004-05. -

"Analogisieren" also zurück von DVD auf Super-8
Film-Mechaniker antwortete auf Guest_Rudolf 51's Thema in Schmalfilm
Ja. Gigabitfilm ist aber schon eine kleine Familie von hochauflösenden Silbersalzfilmen geworden mit den Empfindlichkeiten 40, 32, 25 und 8 ISO. Der letztgenannte deckt, Dichte log 3.0 läßt sich erreichen. Panchromasie ist da jedoch nicht. Das Material harrt noch der Konfektion als Kinefilm. Rudolf könnte auf Gigabitfilm 40 Zwischennegative machen. Davon ließen sich Positive auf dem 8er ziehen. Gigabitfilm 25 ist übrigens nicht mehr erhältlich. Ich weiß nun nicht, ob er wieder kommt, das war ein Wahnsinnsplanfilm (4" × 5"). Auch offen ist die Frage nach dem 40er in einer Konfektion 320 (Rollfilm). Leider sagt mir der Geschäftsführer der Gigabitfilm-G. m. b. H. nichts dazu. Der Sultan winkt, Zuleima schweigt und zeigt sich gänzlich abgeneigt. -

"Analogisieren" also zurück von DVD auf Super-8
Film-Mechaniker antwortete auf Guest_Rudolf 51's Thema in Schmalfilm
Das habe ich erst jetzt gesehen, Rudolf, Hilfe naht, wenn auch spät. Also, ich kenne das Material, habe es in 35 mm verdreht und entwickelt. Der russische Polypan hat keinen Lichthofschutz, ist auf farblosem Polyester vergossen, nicht so grobkörnig, wie man oft liest (was mit laienhafter Entwicklung zu tun hat), und wirklich nicht das Geeignete für das Vorhaben. Er ist auch nur in 35, perforiert, erhältlich. Meine Empfehlung: Kopierfilme, wenn nicht der sagenhafte Gigabitfilm Gigabitfilm, dünn, habe ich 2005 in 16 mm eingeführt, einseitig perforiert, keine Signatur. Es gibt die Möglichkeit, 16-mm-Material mit Normal-8 oder Super-8-Perforation zu versehen, Trägerdicke 0,1 mm. Die Verhandlungen beginnen einfach bei jeweils 20’000 Fuß (6 Kilometer). -

"Analogisieren" also zurück von DVD auf Super-8
Film-Mechaniker antwortete auf Guest_Rudolf 51's Thema in Schmalfilm
Bislang bei diesem Faden nicht mitgemacht habend möchte ich doch zum Ausdruck bringen, daß ich es eigentlich ganz toll fände, wenn 8-mm-Kopien von guten Filmen käuflich erwerbbar wären. Auf welchem Wege auch immer es dazu kommen mag, ist mir wurscht, wenn die technische Qualität der früheren Kleinfilmabzüge nur übertroffen ist. Ich habe einen schwarzweißen Zusammenschnitt vom Baron Münchhausen mit Albers in Normal-8, stumm. Daneben einen bunten Zusammenschnitt eines Disney-Spielfilms in Super-8 mit Lichtton. Solche Sachen waren einst wohlfeil beim Fotohändler, später im Warenhaus. Ich verspreche, mit brauchbaren Produkten in Zukunft neuen guten Kopien auf den Weg zu helfen. Das erste soll eine Entwicklungsausrüstung mit Spiralen sein. Ich habe das a. a. O. bereits angedeutet. Es sollen hochwertige Spiralen sein für Berufsarbeit, Längen bis 500 Fuß sollen in Spirale bearbeitet werden können. Bei der Filmbreite mußte ich aber bei 16 mm aufhören, darunter stimmt einfach der Anspruch nicht mehr, d. h. 9,5 oder 8 haben eine zu kleine Gewinnaussicht. Da müßten Hunderte von Kunden aufkommen, die ja alle nicht mehr als die Herstellungskosten bezahlen wollen, um mich umzustimmen. Wer mit der 16er Kamera anfängt, zielt doch schon auf ein anderes Publikum ab. Rudolf, so müßtest du auf Doppel-8 oder DS-8 belichten und entwickeln. Vorteile: Kameras mit 400-Fuß-Magazin in diesen Formaten sind erhältlich (Pathé, Bolex), Rohfilm zum Kopieren auch (Kodak Vison Color Print Film 3383, Perforation Normal-8, Katalog-Nr. 1048032, Perforation 2 × Super-8, Katalog-Nr. 1807858; Orwo PF 2). Vielleicht aber bin ich gar an der falschen Adresse hier, sagt es mir. -

"Analogisieren" also zurück von DVD auf Super-8
Film-Mechaniker antwortete auf Guest_Rudolf 51's Thema in Schmalfilm
Macht euch jetzt endlich vom Acker, das hier ist das Filmvorführerforum und wer noch nicht wenigstens eine Stirnglatze hat von einem Nitrofilmbrand oder das Filmkittzittern, darf nichts schreiben! Alles unter 35 Millimeter ist Spaghetti, schon 35 Millimeter ist auf der Grenze, besser ist 70 Millimeter. Alles unter 500 Plätze ist kein Kino. Auf der Leinewand dürfen nur Claudia Cardinale erscheinen, Charles Bronson, Baloo und Totò. Es ist nur Hochintensität-Kohlenlicht überhaupt anständig, Röhrenverstärkung, Dias von 6 × 6 Außenmaß aufwärts. Der Computer darf höchstens 800 kHz schnell sein, muß Diskettenlaufwerke haben und angeschlossenen Nadeldrucker. Auch erlaubt sind Typenradschreibmaschinen über Modem. -

Was tun, wenn der Film nicht auf dem Teller bleiben will (Teil 1 & 2)
Film-Mechaniker antwortete auf stkunzmann's Thema in Technik
Kennt Ihr so etwas? -
Wir wollen dir doch nicht die Freude nehmen, selber über viele Jahre herauszufinden und zu verstehen, was so ein trockenes Buch nicht bieten kann.
-
Ich hatte Amorce im Handel, Normal-8 und Super-8, 16 mm, Split, 35 mm. Manches bezog ich aus den Vereinigten Staaten, anderes in Europa. Ganze 300-m-Rollen habe ich nicht verkauft, weil die Ware hundalt war und geschrumpft (Acetat). Wenn man weniger Anstände hat mit weißem Vorspann, dann deshalb, weil er frischer ist, als was man in Grün oder Rot so bekommt. Der Punkt ist also die Perforation.
-
Wenn ich ein wenig am Nimbus der Schweiz kratzen darf: Bessere Objektive gab es. Ein Name, den ich nennen muß, ist Staeble. Ich habe mit einem Staeble auf einem billigen Agfa-Projektor meine eigenen 8-mm-Filme gesehen, wie ich sie vorher nie sah. Da stinkt Kern ab. Du kannst die Güte der Aufnahmeobjektive nur erkennen, wenn das Wiedergabeobjektiv auch gut ist. Der 18-5 ist ein lustiger Apparat, doch wirkliche Leistung bringt er nicht mehr als andere. Es gibt auch Projektoren, die leiser laufen als der 18-5, Kameras, die leiser laufen als die Paillard. Bei der Laufzeit schlägt Pathé die Paillard, beim Filmeinfädeln schlägt Beaulieu die Paillard, bei der Belichtungshilfe schlägt Eumig die Paillard. Beim Unterhalt schlägt Bell & Howell die Paillard. Bei der Gehäuseform schlug bis 1963 vieles die Paillard. Auch eine Niezoldi & Krämer hat perfekte Andruckplatte, auch Suchanek-Meopta hat Wickelzahntrommel. Die Meopta-Objektive sind übrigens ebenfalls in der Oberliga dabei.
-
Ja, die deutsche Industrie-Norm hat in Deutschland noch Gültigkeit wie die SN bei uns. In ISO 2907, Höchstmaße für die Projektion von 35-mm-Film, steht: It is intended that the actual projected image area be the largest appropriately shaped figure that can be inscribed within the specified dimension. Das heißt: Es ist das Ziel, daß die tatsächlich projizierte Bildfläche die größte angemessene Figur ist, die den angegebenen Maßen eingeschrieben werden kann. Damit wird Schräg- und Schiefprojektion Rechnung getragen. Als Breite des maximalen Ausschnitts ist 21,11 mm angegeben, für die Höhe 15,29 mm. Das entspricht dem Seitenverhältnis von 1:1,38. ISO 2906 regelt das Bild bei der Aufnahme. Das Normalbild muß mindestens 16,00 mm hoch und 21,95 mm breit sein (CinemaScope mind. 18,60 mm). Man darf bei frischen Kopien grundsätzlich diese Maße erwarten. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß ich mit jedem Normalbildfilm, den ich meinem Publikum spielte, selber den Anspruch aufbaute, möglichst alles davon zu zeigen, was auf dem Film drauf ist. Kameraleute haben für die Produktion sorgfältig kadriert, Assistenten haben die Schärfe eingestellt, Beleuchter haben geschwitzt. Im Kino ist das Bild das Wichtigste, ich habe also die Pflicht, das Bild unbeschnitten auf die Wand zu bringen. Natürlich ist der Bildstrich nicht interessant, aber wenn ein Mal zwischendurch etwas Bildstrich sichtbar wird, finde ich das weniger schlimm, als das Ganze unvollständig zu verkaufen. Es ist sogar erstaunlich, wie weit gegen die Bildränder hinaus manchmal das Geschehen geht. Europäer sind da spitzer als andere. A propos unvollständig, schlimmer als zu enger Bildausschnitt ist Längenverlust. Diese Diskussion müßten wir wahrscheinlich separat führen, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, daß ein zahlender Besucher das Recht auf den ganzen Film hat. Nur wissen die Kinobesucher nicht im Voraus, wie lang ein Film ist. Aus dem Grund habe ich Mitte 1990er Jahre in den Kleinanzeigen („Kinomagnet“) jeweils eine unscheinbare sechsstellige Zahl eingebaut, die von mir aus der gelieferten Kopie ermittelte Bilderzahl. Man konnte sich also die genaue Laufzeit ausrechnen und mit der Stoppuhrfunktion seines Handys überprüfen. Die Grenze für fehlendes Material setzte ich bei 0,5 % an, das sind beim 100-Minuten-Film 30 Sekunden. Eigentlich schon zu viel. Das waren noch Zeiten, als ich den Verleihern telefonisch Betrüger an den Kopf warf, wenn in den Kopien minutenweise Inhalt fehlte. Viele Kopien, für die man so Frechheiten wie Handling-Gebühren des Archives zahlen muß, haben Längenverluste von zwei bis fünf Minuten. Zurück zum Bild. Die Kinobildwand hat seit 1909 das Seitenverhältnis von 3:4. In den 1950ern sind dazugekommen CS, erst 1:2,55 und später 1:2,35. Daneben hat man 3:5, 4:7 und 7:13. Mir gefällt das Normalbild am besten. Es ist das dynamische Dreieck 3-4-5 darin enthalten, der beschwingte ¾-Takt steckt darin. Es gibt keinen größeren optischen Genuß, als The Third Man auf einer großen Normalbildwand zu sehen, ich meine so 6 auf 8 Meter . . .
-
fcr, wenn du wissen willst, in welchem Zustand die Kamera sich befindet, dann lasse sie mit 12 B./s laufen und kippe sie langsam nach hinten. Der liegende Regler steht dann auf dem hinteren Lager. Wenn’s rappelt, dann ist die Mechanik trocken und benötigt Schmierung. Eine Überholung mit Abschmieren ist die Investition wert. Erstens läuft die Kamera ruhiger, zweitens stimmen die Bildfrequenzen wieder, drittens kann Rost oder Sand entdeckt werden (man weiß nie, wo das Gerät schon war), viertens freuen auch die Objektive sich über Pflege. Ein versierter Mechaniker macht das für 150 Euro.
-
1200 Watt elektrische Lampenleistung bei 43 Ampère und 28 Volt habe ich in Erinnerung vom letzten Kohlenbetrieb, Conradty-Kohlen. Der Abbrand betrug recht genau 4 mm pro Minute, so daß ich mit 15-Zoll-Anoden (381 mm) eine Stunde spielen konnte. Die Reste hätten noch für einen Akt gereicht, ich behielt sie aber für den Dixi auf. Manchmal gab es 16-mm-Film im Vorprogramm. Kohlenreste werden auch im Diaprojektor aufgebraucht. Der Dixi 724 hat ein Strong-Kohlenhaus für 900 Watt el. Leistung (gut 30 A, knapp 30 V). Abbrand etwa 3 mm pro Minute, Anodenlänge 10 Zoll (254 mm) minus Haltelänge = knapp 200 mm. Eine Stunde ununterbrochene Projektion ist also möglich. Mit zwei Projektoren kann man einen Sechsakter auf je einem Kohlenpaar spielen.
-
Man halte sich an die Bildhöhe. Die Formel ist: Brennweite = (Projektionsdistanz × Filmbildhöhe) / Bildhöhe an der Wand Beispiel: (20'000 mm × 15,75 mm) / 3150 mm = 100 mm Die Filmbahneinsätze in den Projektoren fürs Normalbild („Academy“) haben Öffnungen von 15,75 × 21 mm (3:4). So groß dürfen sie schon sein, ich finde, mit einer Höhe von weniger als 15,6 verliert man zu viel Bildinhalt. CinemaScope-Lichtton erlaubt laut ISO 2939 die Höhe 18,60 mm und in der Breite 21,77 mm (1:2,34). Die Feinabstimmung erfolgt mit der Bildwandmaske auf 1:2,35.
-
Hallo, Freunde Ein Freund von mir hat sich eine alte Kopiermaschine angelacht. Es handelt sich um einen Schrittkontaktapparat von Arnold & Richter, Typ BIII / BT / U, N° 2142. Meine Bitte an den/die Betreffenden ist, im Firmenarchiv mal diskret nachzuschauen, ob sich folgende Vermutung bestätigen läßt, und zwar daß es sich um Maschine 21 aus dem Jahre 1942 handelt. Damit wären wir bereits glücklich.
-
Wer Freude am Selbermachen hat, nur zu. Wer das Filmen teuer findet, sollte die Entwicklung vielleicht besser nicht in der Pütz machen. Wer richtig sauber entwickelte Aufnahmen haben will, denkt über Spiralen nach.
-
Vielerorts sind es bereits mehr als 230 Volt, so 233 bis 235. Einstellung also auf 240