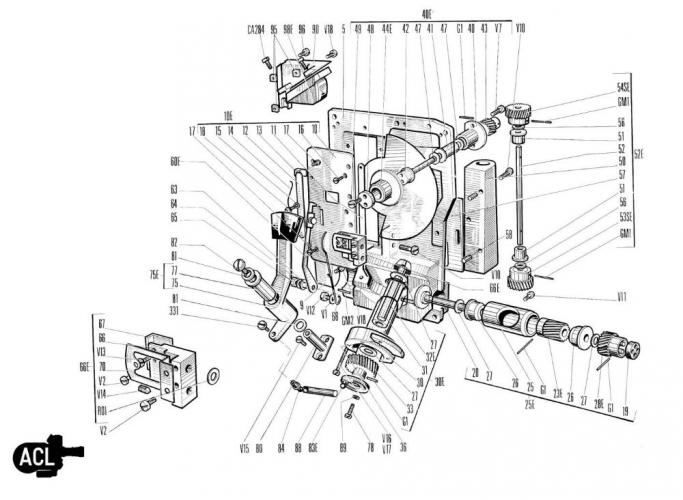-
Gesamte Inhalte
8.265 -
Benutzer seit
-
Letzter Besuch
-
Tagessiege
215
Inhaltstyp
Profile
Forum
Galerie
Alle erstellten Inhalte von Film-Mechaniker
-
Macro-Gerät mit Yvar 75-2.8 http://www.ebay.co.uk/itm/Bolex-Kern-Yvar-75mm-f2-8-Macro-lens-and-Bellows-Kit-for-Cine-/301183289351?pt=Camera_Lenses&hash=item461fec4807
-
Warum zählt die Ansicht der Herren Pitterling und Hoefer mehr als deine eigene? Da liegt des Pudels Kern im Pfeffer. Kann doch jedem egal sein, wer Bolex-Fan ist, ich nehme Rudolf51 nichts weg von seinem Enthusiasmus für die Marke. Es sind noch andere da, die meine Beiträge verstehen. Dafür: Danke Man kann auch Beaulieu-Fan sein, man kann in Nostalgie schwelgen und Dinge sammeln, wie man will. Ich schreibe über das Verhältnis Technik-Geld. Wenn du eine CP zum Fenster rauswürfest, kratzte mich das nicht. Jemand anderes hat nach der ACL gefragt, darauf habe ich geantwortet. Jeder kann selber über die Konstruktion der Eclair A. C. L. nachdenken: Ich würde zu gerne deine Kameras mal in die Hand nehmen!
-

Die Paillard-Bolex H stürzt vom Sockel
Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm
Das sind wohl die Unterschiede zwischen den Menschen. Die einen haben es gerne in der Hand, die anderen haben Spaß dran, auf den Knopf zu drücken. Es soll möglichst alles in dem Gerät untergebracht sein. Stimmt, das Reflex-Prisma tauscht man eher selten aus und dann soll der Techniker sich damit befassen. Das ist völlig richtig so. Ich bin ja nur am Berichten, was sich mir als Reparateur darbietet. -

Die Paillard-Bolex H stürzt vom Sockel
Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm
Die CP 16 ist besser. -

Die Paillard-Bolex H stürzt vom Sockel
Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm
Hier kommt die Fortsetzung. Ich montiere die neue Fensterplatte mit passender Unterlage, richte ein, ziehe die Schrauben an und messe. Das Auflagemaß stimmt. 20,76 mm auf den Hundertstel Montage der Front, alles einrichten, Höheneinstellung von Vor- und Nachwickler, Einstellung der Schleifenformer, Mechanik in Ordnung. Sucherschacht drauf, Objektive drauf, Blick durchs System auf den Tüllinger Hügel, in etwa 700 Metern Entfernung Kamin, Krane und der im Bau befindliche neue Roche-Turm. Bei 20 m auf der Skala eines Teleobjektives maximale Schärfe, aber keine gute. Ähnlich beim Normalobjektiv. Front wieder ab, Schrauben der Prismenhalterung lösen, Sucherschacht drauf und mit dem Daumen die Prismeneinheit verschoben. Es wird nicht recht scharf. Jetzt nehme ich die Prismenhalterung heraus und zerlege sie. Der Fall ist klar: Die Langlöcher für die Halsschrauben sind zu kurz oder sitzen zu tief. Das Prisma muß entweder weiter nach unten versetzt werden, was im Moment nicht geht, oder die ganze Einheit etwas nach hinten, Richtung Verschluß . . . Für die eine Variante muß ich fräsen, für die andere eine Unterlage zuschneiden. Die neue Prismeneinheit, ich tauschte für den Auftraggeber ein beschädigtes Prisma aus, paßt nicht. Soll ich auf die heutige Firma Bolex losgehen? Nein, das wäre idiotisch. Die Reihen passen nicht zusammen. Auf der Schwenkachse des Prismas sehe ich Unterlegescheiben, falsch eingelegt. Die Achse ist eingepreßt. Weil die Oberkante der Prismeninnenfläche bereits bedrohlich tief steht, müßte ich genau da ansetzen und die Scheiben umlegen. Die Variante Unterlage ist der beste Ausweg. Dafür muß ich hernach mit dem Kollimator noch ein Mal das Prisma genau senkrecht zur Filmebene einstellen. Wer bezahlt mir diese Nacharbeit, für die ich nichts kann? Öl ins Getriebe geben, den Spalt zwischen Gehäuse und Hauptplatine wieder zuspachteln, das konnte sich Paillard als Service vorstellen. Für Reparaturen ist die H-Kamera aber ebenso wenig gemacht wie andere, das steht fest. Ihr Entwurf ist nun 84 Jahre alt, die Produktion hat vor genau 80 Jahren begonnen, vor 45 Jahren war Schluß. Die Zusammenhänge sind vergessen gegangen. Es wird immer teurer werden, Amateurgerät zu pflegen. Es sind alles Verbrauchsartikel. Heute findet man Spiegelreflexkameras für einige Hundert, professionelle Apparate. Wenn es eine Paillard-Bolex sein muß, dann höret meinen Rat: keine Reflex-Modelle. Das bißchen Sucher wiegt die optische Einschränkung nicht auf. Auf jeden Fall kann ein Prismentausch sich unerfreulich entwickeln. -
Zu erwarten bei dem Alter Man braucht der Schrumpfung anpaßbares Gerät, erhältlich bei http://www.hammann-filmtechnik.de/.
-

Treffen für Filmer & Filmsammler - Anregungen, Vorschläge, Terminfindung
Film-Mechaniker antwortete auf Silas Leachman's Thema in Schmalfilm
Das sind keine Romane, sondern Entspannung zu Hause am Rechner nach Anspannung an der Werkbank. Ich habe mich ja selber da hineinmanövriert und will jetzt die Beaulieu auch nicht vom Service ausschließen. Vor der zerlegten Kamera habe ich allerdings schon einige Male geflucht. Screw the Frenchies und so was. Englisch ist nicht abwegig. Das Schiebersystem hat Marcel Beaulieu von Pathé frères übernommen, die Patente waren im Krieg abgelaufen. Die Mechanik der Pathé-Baby-Kamera hat ein Engländer gebracht, Arthur Samuel Newman mit Namen. Der hat Kurbelstange schon 1896 in eine Filmkamera gesetzt, die erste von Newman & Guardia. Im Filmmuseum Potsdam ist eine Newman-Sinclair, auf 1905 geschätzt. Das ist wohl nicht richtig, denn Julio Guardia starb 1906. 1908 verbündete Newman sich mit James Sinclair. Bei Newman hat André Debrie für seinen Parvus abgeschaut. Newman klaute seinerseits bei einem Mechaniker namens Woodhead. So sieht’s aus. Morgen montiere ich die wartende H 16 Reflex und danach wird geschliffen. -

Die Rache der Jeanne-Lise Fournier
Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm
Dann wöge sie vermutlich etwa fünf Kilogramm!- 63 Antworten
-
- 1
-

-

Die Rache der Jeanne-Lise Fournier
Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm
Noch ein Mal hinabgestiegen ins Gestänge und Getriebe der MR8: Das Auge der Greiferstange schlägt bei jeder Umdrehung auf zwei isolierte Kontaktfedern und schließt damit elektrischen Stromkreis zur Masse. Der eine Kontakt liegt vorne und wird bei angehaltenem Getriebe gedrückt, die Belichtungsmessung ist eingeschaltet. Der andere liegt unten und löst Blitz oder Tonimpuls aus. Wie ich aus Beiträgen in anderen Foren zur MR 8 nun weiß, ist Enge ein Problem. Das bauchige Umleitblech, das den Film von der Kurbelscheibe fernhält, läßt nicht nur bei der Kamera von uhuplus sehr wenig Platz für den Kontakt. Beim Montieren glaubte ich, etwas falsch zu machen, doch es gibt keinen Spielraum. Das Umleitblech ist oben mit der Fensterplatte verschraubt, diese ist durchs Gehäuse hindurch mit der Front verschraubt, die Front wiederum quer dazu an der Hauptplatine des Werks und das Werk mit drei Schrauben in der Gehäuseschale befestigt. Ich kann das Werk nicht schieben. Ich kann die Front nicht schieben. Ich kann die Fensterplatte, eigentlich ein Druckgußstück mit eingesetztem Blech, minimal seitlich schieben, nach unten oder oben im Bereich von etwa 0,1 mm. Es ist einfach alles zusammengedonnert. Wegen der beiden Kontaktfedern klappert die Kamera. Ein gewisses Maß an Andruck muß vorhanden sein, sonst ist eines Tages wegen Abwetzung kein Kontakt mehr. Die Kontaktpunkte weisen entsprechende Riefen auf. Viel Aluminium, auch der Haltering zwischen Sucherrohr und Augenmuschel, wo Stahlschrauben natürlich unter Druck das Gewinde nur ausweiten (M1,2). Die Andrückplatte aus Stahlblech wird mit zwei Wendelfedern von einem Halteblech gestützt, welches seinerseits mit Bohrungen auf Stützen sitzt. Diese sind in ein formgedrücktes Alublech genietet, das auf Gewindezapfen geschraubt wird. Die Zapfen sitzen in der Hauptplatine. Billig, billig, billig Immerhin, sie flitzt wieder. Gegen Ende gibt die Zugfeder nach. Das kann man bei der Konstruktion nicht vermeiden. Eine neue Feder brächte besseren Durchzug. Man könnte auch die Federvorspannung vergrößern oder die Federsperre entfernen. Man kann jedoch dank umlaufendem Federhaus im Lauf nachspannen und im Prinzip den ganzen Filmvorrat ununterbrochen belichten, zwei Minuten und fünf Sekunden bei Tempo 16. Nach Entfernen der Flachkopfschraube mit Linksgewinde und Stirnlöchern kann man die Aufzugkurbel abziehen. Eine flexible Welle läßt sich auf den Federkern zwingen. Ein Helfer spannt die Feder nach, man ist frei zur Führung von Kamera und Stativ.- 63 Antworten
-
Für die H 16 bliebe nur Avichrome? Da sind doch noch (frisch) Fomapan R 100 Orwo UN 54 Orwo N 74 Orwo PF 2 Gigabitfilm 40 Eastman-Wittner Plus-X reversal Eastman Double-X Eastman 7363, Strichfilm und die vier Kodak-Vision-Farbnegativfilme. Überlagert von Kahl: Imation Scotch Chrome 100
-
Eine nur ganz kleine Anmerkung, die Bohrungen haben einen kegeligen Längsschnitt. Immer wieder gut, über Mechanik zu lesen, ich bekomme nie genug. Gute Bilder!
-

Die Rache der Jeanne-Lise Fournier
Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm
http://web.hasler.ch...Id=25.4050.0300 uhuplus hat mich eben am Telefon getröstet, für ihn habe ich einen Hilferuf im Internet geschrien. Dabei ist die Kamera montagefertig. Es war einfach alles recht heftig heute, auch der 12jährige Kevin, dem ich Deutschnachhilfe gebe. Wenn ich Zeitwort sage, guckt er mich mit Riesenaugen an. Wenn ich Verb sage, nickt er wissend. Man sollte die Schulen schließen.- 63 Antworten
-

Die Rache der Jeanne-Lise Fournier
Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm
Ähm, der Preis, da will einer in der Schweiz Fr. 17.50 für die 80-ml-Tube.- 63 Antworten
-

Die Rache der Jeanne-Lise Fournier
Film-Mechaniker antwortete auf Film-Mechaniker's Thema in Schmalfilm
Mastix. Das Gehäuse unter der Frontplatte ist gerundet. Ihr wißt ja, die Kurven dieser Französin. Es geht um zwei Haaresbreiten Luft, das muß abgedichtet werden. Die vorhandene Dichtmasse ist bei der Demontage natürlich gebrochen. Ich also zum nächstgelegenen Händler entsprechender Materialien, er hat nur die Kartuschen mit Silikon-Fugenmasse, 10 Franken plus Mwst. Ein anderer, etwas weiter, bietet für Fr. 8.40 an, also Drahtesel gesattelt und hin. Lustige junge Verkäuferin, ich fröhlich zurück zur Werkstatt. Beim Aufschneiden der Kartusche glänzt’s, ich also frohgemut die Spritztülle aufgeschraubt und Druck gemacht . . . Nichts. Tülle weg, mit dem Schraubendreher hineingepult, alles gummig. Schraubendreher bis zum Heft in die Kartusche eingestochen, kommt trocken heraus. Wieder aufs Velo, zurück zur Verkäuferin. Sie ist voller Verständnis für meine nun angeknackte Stimmung — unterwegs habe ich am Hinterrad auch noch einen Platten eingefangen — zückt ein Teppichmesser und schneidet zur Prüfung eine andere Kartusche an. Alles ein Klotz da drin. Rufe Ruedi Muster an, ob er wisse, wo man Mastix beziehen kann. Von Bolex werde er mit nichts mehr beliefert, sagt er, und was Bolex noch an Dichtmasse hat, wäre auch alt. Zum Glück hat er Projektoren zur Reparatur. Die brauchen keine schwarze Dichtmasse. Was für ein Tag! Vollmond, ist ja klar. Mittlerweile kenne ich das Rezept für Mastix, diese seit Jahrhunderten bekannte Fugenmasse, die seit den Anfängen der Fotografie auch geschwärzt in Gebrauch ist. Die vielen Jahrzehnte der Holzkameras mit Balgen und Rahmen, Héliogravure, Daguerréotypie, Ferrotypie, Naßkollodion- und Trockenplattenverfahren, immer waren Ritzen und Fugen lichtdicht zu machen. Das setzte sich also bis zum Ende des Amateurfilmkamerabaus fort. Der Entschluß reift in mir, schwarzes Mastix selber herzustellen und zu vertreiben. Ein Produkt mehr neben Paratax, Memochrome, Hakoko und Filmspalter Morgen in eine andere Filiale mit einem Gutschein vom lustigen Fräulein. Vielleicht finde ich in Basel noch eine brauchbare Portion schwarzer Silikonmasse. Das echte Mastix besteht nur aus natürlichen Stoffen, es kann noch nach Jahren, wenn es längst hart geworden ist, wieder aufgelöst und verarbeitet werden. Es kann auch in die Natur hinausgeworfen werden, wo es rasch abgebaut wird. Von Ameisen. Der moderne Kunststoff muß als Sondermüll restentsorgt werden. Ich hätte wohl einfach eine Tube UHUplus mit etwas Farbe vermischen sollen, das hätte auch gepaßt, oder, uhuplus?- 63 Antworten
-
- 4
-

-

Suter-16, das etwas andere Filmformat...
Film-Mechaniker antwortete auf Guest_Rudolf 51's Thema in Schmalfilm
Mein dreitausendunderster Beitrag :wacko: Morgen geht’s weiter mit der Bohljöö. :) -
Emel C 93
-
Mit Vornachwickler: Ciné-Kodak 8 Suchanek-Meopta Admira 8 Niezoldi & Krämer 8 Revere 88 Lévêque LD 8 So auf die schnelle
-
Habe eben wieder das Wunder der Auferstehung erlebt mit Reinigung des Suchersystems der Beaulieu MR 8. Ein Problem dabei ist, dass die Mattscheibenlinse (gegen den Schwingspiegel hin plan und mattiert, auf der anderen Seite konvex) mit Mastix eingeklebt ist. Die sauber zu bekommen und zu halten, bis alles montiert ist, grenzt an Hochseilakrobatik über einem brodelnden Vulkan. Meine persönliche Glasreinigungsmethode hat sich so weit bewährt, einen Moment lang glaubte ich, das Mastix spiele mir einen Streich, doch dann fand ich den Dreh. Den Hauptanteil machten die Linsen im Rohr aus, immerhin 20fache Vergrösserung der winzigen Mattscheibe. Hier ein Link für an hellerer Mattscheibe Interessierte.
- 26 Antworten
-

Wie lange gab es denn die "Sprossenschrift"?
Film-Mechaniker antwortete auf trutz-guenther's Thema in Nostalgie
TOBIS-Klangfilm und Siemens nutzten das Verfahren, nach dem Zweiten Krieg Maurer und andere in Amerika. -

Wie lange gab es denn die "Sprossenschrift"?
Film-Mechaniker antwortete auf trutz-guenther's Thema in Nostalgie
Berglund erfand die Vielfachzackenschrift, Patent auf Kammblende. Nach Trennung von Ernemann ist er damit weitergezogen, ich kann jetzt grade nicht sagen, wohin. Patent erloschen August 1932 -
Es soll abwerten, ich bin Filmtechniker, dem die Berufsgrundlage abhanden gekommen ist. Die dem von mir verhaßten Rationalismus entsprechende Siedlungsform ist nicht Städtebau der italienischen Renaissance, den viele als Touristen gerne genießen gehen, sondern die vollkommen gesichtslose rechteckige Blockstruktur der nordamerikanischen Orte. Das uranische Zeitalter hat das plutonische abgelöst, ist mir völlig klar. Der Film gehört noch der alten Zeit an oder ist ein Produkt des Übergangs, der von 1894 bis 1967 dauerte. Film ist körperlich, materiell, Video und Computertechnik sind immateriell. Es geht allein ums Rechenprogramm. Das finde ich langweilig.
-
Todd-AO (nicht 0) ist das 65-mm-70-mm-System, veröffentlicht 1955. Preisgünstiger war CinemaScope, jedoch bildlich nicht so gut.
-
Das Polyethylenterephthalat, ein Polyesterkunststoff, ist chemisch inert. Das heißt, es geht bei Normalbedingungen keine Verbindungen ein und wird von Wasser nicht benetzt. Damit nun doch ein Polymer, wie Gelatine eines ist, darauf hält, wird die Folie mit Elektronen beschossen, im elektrischen Feld ionisiert. Dieses Verfahren öffnet sozusagen die Oberfläche und ermöglicht feste Verhaftung mit einer dünnen Grundgelatine, dem so genannten Substrat (Unterzug). Auf dieses kann später ohne weiteres die fotografische Beschichtung aufgebracht werden. Die Technik gibt es seit den 1940er Jahren.
-
Damit liegst du recht falsch. 1962 gab es keine Videotechnik, mit der man auch nur über 16 mm hinausgekommen wäre. Lawrence ist auf Breitfilm aufgenommen worden, viel teurer bei der engsten Fimtechnik als 35 mm. Was das Theater betrifft, sind wir uns einig. Solche Breitwandschinken müssen auf große Bildwände gespielt werden.
-
Keine böse Absicht, Mirko!